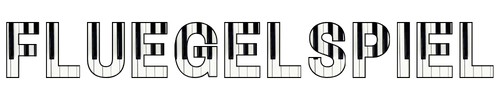Nun hatte ich es mir eingebrockt: Ich hatte zugesagt, an den Chopin-Abenden der Musikschule, an der ich Klavierunterricht hatte, die Mazurka op. 33 Nr. 4 vorzuspielen. Ich hatte meinen Schwur, (in meinem Alter) nie ein Konzert zu spielen, gebrochen.
Den Schwur hatte ich getan, weil ich mir damals ein Musikschulvorspiel vorstellte, das mit den Kleinen begann und mit mir Alten endete…
Doch das Konzert fand im schönsten Konzertsaal der Stadt mit einem Steinway-D als Konzertflügel statt und war gar kein reines Konzert, sondern ein Spiel- und Lesestück mit verteilten Rollen, das das Leben von Frédéric Chopin (1810 – 1849) nachzeichnete, mit Untermalung durch entsprechende, von ihm komponierte Stücke. Und deshalb, unter anderem, stach mich der Hafer.
Ich hatte also JA gesagt, mit allen entsprechenden Folgen.
Der Weg der Vorbereitung auf das Konzert war nicht nur mit spieltechnischen, sondern auch persönlichen Herausforderungen gepflastert, erforderte er von mir doch eine große Portion Mut. Doch im Laufe der Vorbereitung wurde mir immer deutlicher, dass mein Beruf als Konferenzdolmetscherin die ideale Vorbereitung auf die mentalen Herausforderungen war, denen ich als Pianistin begegnete. Bei den persönlichen Voraussetzungen, in der Vorbereitungsphase und schließlich beim Umgang mit der Situation auf der Bühne konnte ich aus meinen beruflichen Erfahrungen schöpfen.
Zur Vorbereitung auf das Konzert musste ich zunächst so viele Informationen über den Komponisten und seine Zeit sammeln wie möglich. Das kannte ich schon, denn auch bei der Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz geht es zunächst um den großen Rahmen der Veranstaltung. Ich hatte festgestellt, dass das Dolmetschen für mich umso leicht wird, je breiter mein allgemeines Wissen rund um das Veranstaltungsthema ist. Das konnte ich gut auf die Konzertvorbereitungen übertragen.
Dann ging es um das Klavierstück selbst. Wann wurde es unter welchen Umständen geschrieben? Was ist seine Aussage, und wie ist es in allen Details aufgebaut? Auch diese Art der Vorbereitung war mir bekannt, denn nach der allgemeinen Vorbereitung auf die zu dolmetschende Veranstaltung geht es um die detaillierte Einarbeitung in die Reden und Präsentationen, die gehalten werden sollen.
Aber das war die Theorie – nun kam das praktische Üben. Ich teilte das Stück in seine einzelnen Teile, suchte nach Wiederholungen und ergründete seine Struktur. Dann musste ich den Notentext entschlüsseln und auf die Tasten bringen. Ungewohnte Bewegungen, harte Schnitte zwischen traumhaften Zaubermelodien und lautem Aufbäumen, Überleitungen, die nicht nebensächlich geraten durften, und ein Schluss, der vollkommene Tastenbeherrschung bei sehr leisem Spiel erforderte.
Ich übte mit Begeisterung, ohne Begeisterung, manchmal mit tiefer Freude über die von mir produzierten Klänge, manchmal vollkommen mechanisch, obwohl ich mir doch so Mühe gab, das Instrument zum Klingen zu bringen. Manchmal wurde es langweilig, dann bestand die Herausforderung für mich darin, es mir wieder interessant zu machen. Manchmal schien es, als hätten meine Hände und der Kopf komplett vergessen, was ich schon geübt hatte. Dann wurde der Frust zu einem zuverlässigen (und lästigen) Begleiter. Manchmal übte ich mit Wut, weil etwas zum hundertsten Mal nicht so klappte, wie ich mir das vorgestellt hatte, und manchmal brach ich das Üben auch ab. Die Sprünge in der linken Hand an einigen Stellen brachten mich zur Verzweiflung. Eines Tages hatte ich genug, band mir die Augen zu und übte die Sprünge blind. Nach einer halben Stunde hatte ich mörderische Kopfschmerzen. Zwar hatte sich die Rosskur gelohnt, und die Sprünge klappten fast perfekt – aber leider nur fast, und bis zum Konzert selbst sollte sich das auch nur noch unwesentlich verbessern…
Mut war gefragt – der Mut weiterzumachen, wenn ich aufgeben wollte, der Mut, auch dann an das Erreichen meines Zieles zu glauben, wenn ich den Eindruck hatte, nicht voran zu kommen, und der Mut, nicht auf die Stimme zu hören, die manchmal ziemlich laut flüsterte: „Siehst du, das hast du nun davon! Du hättest es nicht tun müssen, ich hab dir ja gleich gesagt, dass das wahrscheinlich nicht klappt! Und dass du so etwas in deinem Alter doch gar nicht mehr brauchst!“
Aber ich machte weiter, trotz der Stimme. Irgendwann war es zu spät umzukehren, also hatte ich gar keine Wahl. Was manchmal ja auch nicht schlecht ist.
Ich ging weiter, immer weiter, und das Stück wuchs und wuchs. Es wanderte langsam von den Noten auf dem Papier in mich hinein. In mir bildete sich eine innere Landkarte, von der ich irgendwann jeden Abzweig, jeden Abgrund, jede zu erklimmende Steilwand, jeden kleinen Bachlauf und jede liebliche Wiese zum Ausruhen kannte.
Dann kam das Auswendiglernen. Das war wie Vokabeln lernen. So, wie ich mir Terminologie für einen Dolmetscheinsatz einpauken muss, musste ich auch das Stück auswendig lernen. Kann ich gerade nicht genau einordnen, wovon der Redner spricht, hangele ich mich so lange an der Terminologie entlang, bis ich wieder voll und ganz im Bilde bin. So ähnlich war es mit dem auswendig gelernten Klavierstück. Es bot mir nun nicht nur eine innere Landkarte des Stücks, die ich durchwandern konnte, sondern auch die Vogelperspektive, so dass ich wusste, dass bald diese besonders fiese Klippe kam, und wie ich sie um sie herum kam. Natürlich habe ich mich Konzert verspielt (hat man das gehört???), aber ich konnte trotzdem weiterspielen, weil ich genau wusste, wo ich war. In der dazu notwendigen Konzentration über lange Strecken und die Fähigkeit, mich selbst wieder einzufangen, wenn ich geistig abgeschweift war, war ich durch meine Dolmetscherfahrung geschult.
Weil man bei einem Dolmetscheinsatz (und einem Konzert) immer damit rechnen muss, dass etwas schief geht, lernt man so viele Vokabeln und liest sich alles um das Thema herum an, was man in der vorhandenen Zeit schaffen kann. Ebenso lernt man das Klavierstück auswendig, bis man die Landkarte samt Vogelperspektive darauf in sich trägt.
Bei einem Dolmetscheinsatz kann es vorkommen, dass der Redner von seinem Thema so begeistert ist – oder dass er dermaßen nervös ist -, dass er viel zu schnell spricht. Oder das Mikrophon fällt plötzlich aus, und man muss improvisieren, damit die Veranstaltung reibungslos weitergehen kann. Dazu braucht man einen Fundus an Wissen, Erfahrung und Stressresistenz, aus dem man in solchen Situationen schöpfen kann. Und mit einem solchen Fundus wollte ich das Konzert ebenfalls angehen, damit ich darauf vertrauen konnte, dadurch in der Lage zu sein, mit den unbekannten Bedingungen auf der Bühne angemessen umgehen zu können.
Bei Dolmetscheinsätzen steht oftmals eine schalldichte Kabine bereit, die man sich mit dem Teampartner teilt. Mir hilft dieser kleine, abgeschlossene Raum, mich schnell in die Veranstaltung einzufühlen. Es ist unser Raum, klein, aber definiert, und gemütlich gegen äußere Einflüsse abgeschlossen. Aber, so musste ich feststellen, auf der Bühne war weit und breit kein Raum zum Verschwinden vorhanden, auch kein Teampartner, der mich im Zweifelsfall hätte unterstützen können, sondern ausschließlich viel Luft und freie Fläche um mich herum, eine ungewöhnliche Beleuchtung, eine neue Akustik und ein unbekanntes Instrument (aber was für eines!). Das einzige, an dem ich mich innerlich festhalten und auf der Bühne verankern konnte, war die Tastatur des Flügels – eine sehr kleine Fläche angesichts des weiten Raumes um mich herum…
Und schließlich gibt es in beiden Szenarien die Zuhörer, um derentwillen man das alles auf sich nimmt. Beim Dolmetschen beobachte ich, ob sie mir folgen. Sehe ich, dass sie nicken oder lachen, oder habe ich sie verloren, weil sie unruhig sind? Auf der Bühne war es genauso. Ich lauschte mit einem Ohr, ob ich die Zuhörer hatte einfangen können. Waren sie bei mir, gingen sie mit, oder mussten sie sehr husten? Das ließ sich am besten an den sehr leisen Stellen prüfen. Die Zuhörer rührten sich nicht, vor allem am Schluss nicht, bis ich sie entließ. Also waren sie wohl von der Musik gefangen gewesen.
Zu guter Letzt gilt für beide Berufe: Aufgeben gilt nicht! Es gibt nur alles oder nichts – wobei „Nichts“ genau genommen gar nicht zur Wahl steht. Ich kann weder aus der Dolmetschkabine flüchten noch von der Bühne rennen, wenn etwas nicht klappt. Ich kann nur die Zähne zusammenbeißen und alles in Würde zu Ende bringen.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich erstaunt war zu sehen, wie stark ich während der Konzertvorbereitung von meiner Berufserfahrung profitieren konnte. Allein schon das war den Mut wert, den ich für dieses Konzert aufbringen musste. Vielleicht hätte ich diesen Mut ohne meine Berufserfahrung gar nicht gehabt, denn es gab Zeiten, da erforderte jede neue und damit unbekannte Dolmetschsituation von mir eine große Portion Mut. Inzwischen hat der Mut beim Dolmetschen der Erfahrung Platz gemacht.
Wird mir das auch in der Musik gelingen?